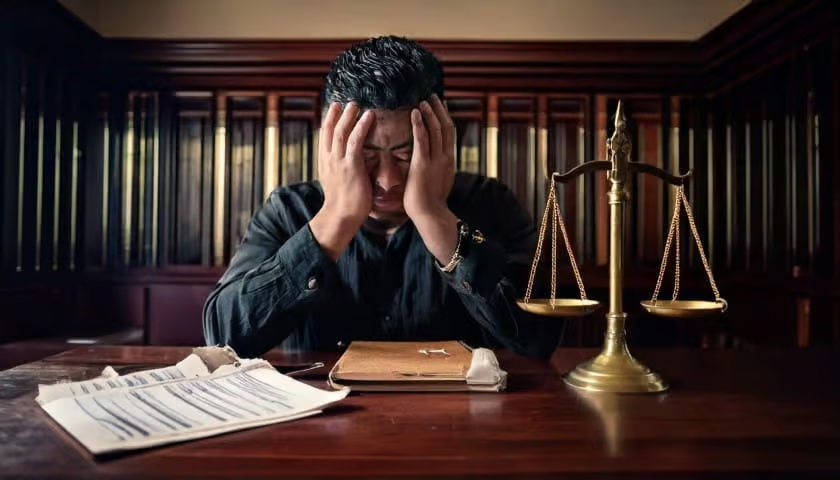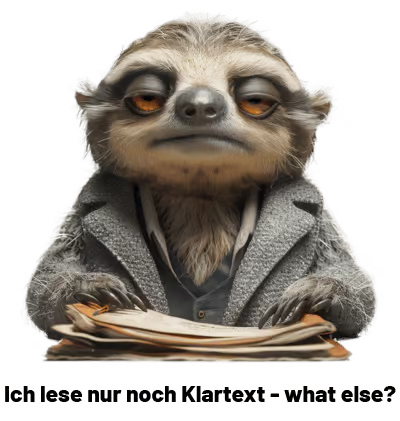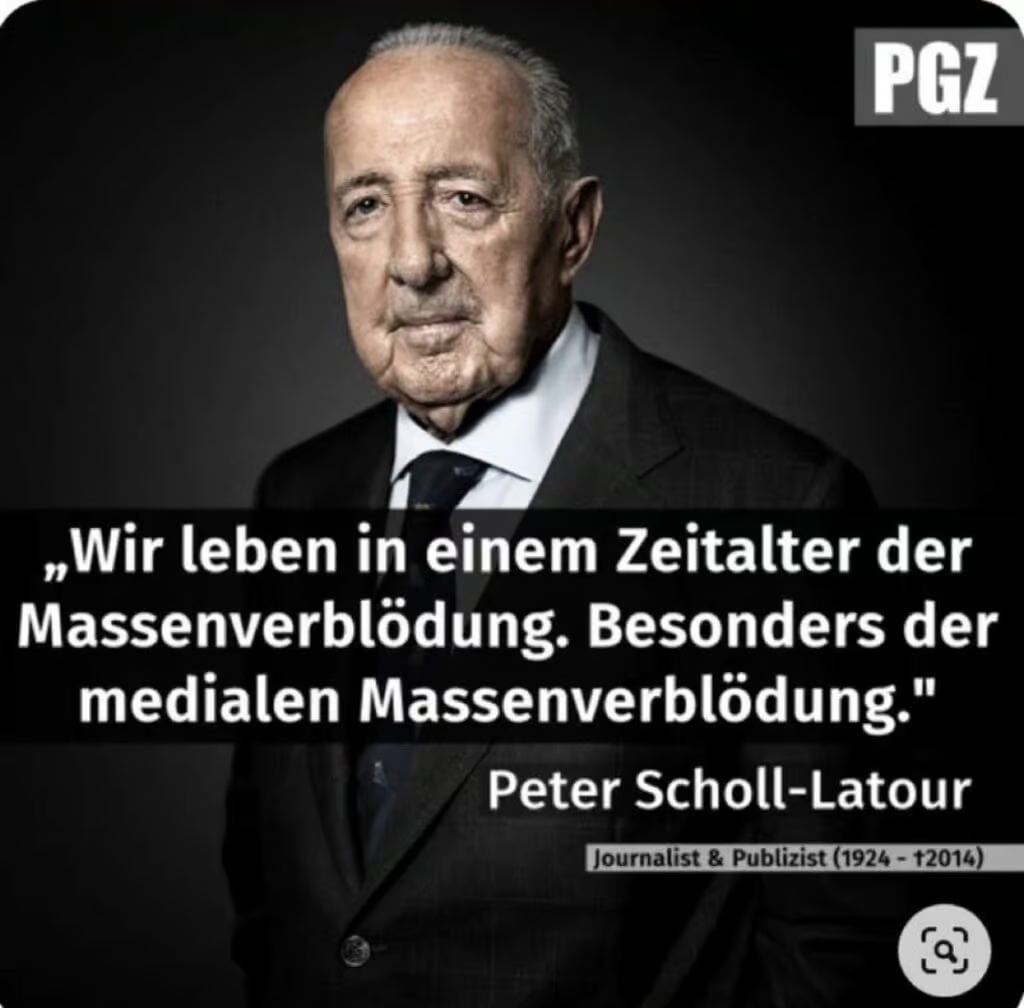Immer mehr Menschen sind über Gerichtsurteile irritiert, da diese als unverhältnismäßig oder ungerecht empfunden werden. Dies führt zu der allgemeinen Wahrnehmung einer zunehmend ungerechten Rechtsprechung und damit zu einem ernsthaften gesellschaftlichen Problem. Dies liegt vor allem daran, dass Gerichte ihre Möglichkeiten, Urteile nach „Recht und Gesetz“ zu treffen, nicht ausreichend nutzen. In diesem Artikel werden wir das Zusammenspiel von Recht und Gesetz genauer untersuchen und anhand praktischer Beispiele verdeutlichen.
Zusammenspiel von Recht und Gesetz: In der Praxis müssen Urteile sowohl nach dem geltenden Recht als auch nach den bestehenden Gesetzen gefällt werden. Dieser Unterschied ist entscheidend für das Verständnis, warum Entscheidungen als ungerecht empfunden werden.
Gesetze geben klare und spezifische Anweisungen, die von Richtern bei der Urteilsfindung berücksichtigt werden müssen. Sie sind die formelle, schriftlich fixierte Grundlage des Rechtssystems. Beispiele für Gesetze sind das Strafgesetzbuch (StGB) oder das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Diese Gesetze bieten eine klare Richtlinie für Richter, um Entscheidungen zu treffen.
Recht hingegen ermöglicht es den Richtern, über den strikten Wortlaut der Gesetze hinauszugehen und allgemeinere Prinzipien der Gerechtigkeit, Fairness und Moral anzuwenden. Dies ist besonders wichtig in Fällen, in denen die Gesetze Lücken oder Unklarheiten aufweisen. Hier kommen ungeschriebene Rechtsgrundsätze und allgemeine Gerechtigkeitsüberlegungen ins Spiel.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass “Gesetz” den formellen, schriftlich fixierten Teil des Rechtssystems darstellt, während “Recht” den breiteren Rahmen umfasst, der auch ungeschriebene, insbesondere historisch gewachsene und bewährte Normen und Prinzipien beinhaltet. Beide Aspekte sind essenziell für die Justiz und gewährleisten, dass Urteile nicht nur formell korrekt, sondern auch gerecht und fair sind.
Praktische Beispiele Um die Theorie zu veranschaulichen, betrachten wir einige praktische Beispiele, bei denen das Zusammenspiel von Recht und Gesetz eine Rolle spielt.
Beispiel 1: Corona-Rechtsprechung
Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist die Handhabung von Maskenattesten während der COVID-19-Pandemie. Viele Ärzte stellten Atteste aus, die ihre Patienten von der Maskenpflicht befreiten. Dies führte zu einer Vielzahl von Anklagen und Verurteilungen wegen der Ausstellung unrechtmäßiger Atteste.
Gesetzliche Sicht: Laut den während der Pandemie erlassenen Verordnungen mussten Masken getragen werden, und nur unter bestimmten medizinischen Voraussetzungen durften Ausnahmen gemacht werden. Viele Ärzte, die solche Atteste ausstellten, wurden angeklagt, verurteilt und inhaftiert, weil sie gegen diese Verordnungen verstoßen hatten.
Rechtliche Sicht: Ein Richter könnte jedoch zu dem Schluss kommen, dass die Ärzte nach bestem Wissen und Gewissen handelten, um die Gesundheit ihrer Patienten zu schützen. Sie könnten argumentieren, dass die pauschale Verurteilung der Ärzte unverhältnismäßig ist und die individuellen Umstände und medizinischen Gründe jedes Patienten berücksichtigt werden müssen. Hier würde der Richter die Prinzipien der Verhältnismäßigkeit und des Schutzes der individuellen Rechte über den strikten Wortlaut der Verordnungen stellen.
Beispiel 2: Familienrecht Ein weiteres Beispiel finden wir im Familienrecht. Nehmen wir an, dass ein Elternteil das Sorgerecht für ein Kind beantragt, obwohl er seit Jahren keinen Kontakt zu dem Kind hatte.
Gesetzliche Sicht: Nach dem Gesetz hat jeder Elternteil grundsätzlich ein Anrecht auf das Sorgerecht.
Rechtliche Sicht: Der Richter könnte jedoch berücksichtigen, dass das Wohl des Kindes im Vordergrund steht und entscheiden, dass das Sorgerecht nicht gewährt wird, weil der Elternteil bisher keine Beziehung zum Kind aufgebaut hat und dies dem Kindeswohl schaden könnte. Hierbei würde der Richter die allgemeinen Prinzipien der Gerechtigkeit und das Kindeswohl über den strikten Wortlaut des Gesetzes stellen.
Beispiel 3: Arbeitsrecht In einem Fall aus dem Arbeitsrecht könnte ein Arbeitnehmer wegen eines kleinen Verstoßes gegen die Unternehmensrichtlinien gekündigt werden, obwohl er ansonsten ein vorbildlicher Mitarbeiter war.
Gesetzliche Sicht: Die Unternehmensrichtlinien erlauben eine Kündigung bei jedem Verstoß.
Rechtliche Sicht: Ein Richter könnte jedoch entscheiden, dass eine Abmahnung anstelle einer Kündigung angemessen wäre, um der Loyalität und dem bisherigen Verhalten des Arbeitnehmers Rechnung zu tragen. Hier würde das Prinzip der Verhältnismäßigkeit und Fairness zur Anwendung kommen.
Problem: Ungleiche Strafzumessung Immer häufiger kommt es vor, dass ausländische Straftäter bei schweren Delikten wie Körperverletzung, Messerangriffen oder Vergewaltigung mit relativ geringen Strafen davonkommen, während deutsche Täter für vergleichsweise geringere Vergehen härter bestraft werden. Hier sind einige konkrete Beispiele, die diese Wahrnehmung verdeutlichen.
Fall 1: Messerangriff in Hamburg
Ausländischer Täter: Ein afghanischer Asylbewerber verletzte 2018 in Hamburg einen 23-jährigen Mann schwer mit einem Messer und wurde zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Der Richter begründete das milde Urteil mit der schwierigen Lebenssituation des jungen Mannes und der Hoffnung auf eine positive soziale Entwicklung.
Deutscher Täter: Ein deutscher Jugendlicher, der in einem ähnlichen Zeitraum in Berlin einen gleichaltrigen Jugendlichen mit einem Messer angriff und verletzte, wurde zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt. Der Richter führte an, dass die Tat besonders brutal und heimtückisch gewesen sei, was eine höhere Strafe rechtfertigte.
Fall 2: Vergewaltigung in Freiburg
Ausländischer Täter: 2016 wurde ein 22-jähriger afghanischer Flüchtling wegen der Vergewaltigung einer Studentin in Freiburg zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt. Die Strafe wurde als relativ milde empfunden, insbesondere da der Täter mildernde Umstände aufgrund seiner traumatischen Fluchterlebnisse geltend machen konnte.
Deutscher Täter: Ein deutscher Mann wurde im gleichen Jahr in Köln für die Vergewaltigung einer Frau zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Der Richter betonte die Schwere der Tat und die psychischen Folgen für das Opfer als Gründe für die harte Strafe.
Fall 3: Körperverletzung in München
Ausländischer Täter: Ein syrischer Flüchtling, der 2019 in München wegen schwerer Körperverletzung angeklagt war, erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr. Der Täter hatte einen anderen Mann mit einem Messer verletzt, jedoch berücksichtigte der Richter, dass der Täter keine vorherigen Straftaten begangen hatte und sich kooperativ zeigte.
Deutscher Täter: In einem vergleichbaren Fall in Hamburg wurde ein deutscher Mann, der einen anderen Mann in einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt hatte, zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Hierbei spielte die Tatsache, dass der Täter bereits eine Vorstrafe hatte, eine Rolle in der Strafzumessung.
Fall 4: Körperverletzung in Stuttgart
Ausländischer Täter: Ein 19-jähriger syrischer Asylbewerber, der in Stuttgart einen Mann während eines Streits schwer verletzte, wurde zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten verurteilt. Der Richter berücksichtigte die schwierige Fluchterfahrung und Integration des Täters als mildernde Umstände.
Deutscher Täter: Ein 21-jähriger Deutscher, der in derselben Stadt einen Mann bei einem Barstreit schlug und verletzte, erhielt eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung. Der Richter hob die Brutalität des Angriffs und die Notwendigkeit der Abschreckung hervor.
Diskussion der Beispiele: Diese Fälle illustrieren die unterschiedlichen Strafzumessungen und werfen Fragen zur Gleichbehandlung im deutschen Justizsystem auf. Während Richter individuelle Umstände wie Alter, soziale Situation und Reue der Täter berücksichtigen, entsteht der Eindruck einer ungleichen Strafzumessung. Dies untergräbt das Vertrauen in die Justiz in der Öffentlichkeit und zeigt die Notwendigkeit einer transparenteren Kommunikation der Entscheidungsgründe.
Fazit: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass “Gesetz” den formellen, schriftlich fixierten Teil des Rechtssystems darstellt, während “Recht” den breiteren Rahmen umfasst, der auch ungeschriebene Normen und Prinzipien beinhaltet. Beide Aspekte sind essenziell für die Justiz und gewährleisten, dass Urteile nicht nur formell korrekt, sondern auch gerecht und fair sind.
Lösungsansätze zur Verbesserung der Rechtsprechung: Das Justizsystem in einem Rechtsstaat ist in besonderem Maße auf das Vertrauen der Bevölkerung angewiesen. Durch die öffentliche Wahrnehmung von unverhältnismäßiger bis ungerechter Rechtsprechung wird nicht nur das Vertrauen in die Justiz in Frage gestellt, sondern das Vertrauen in die Demokratie, die darauf baut, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind und Rechtsprechung nach „Recht und Gesetz“ erfolgt.
Um die Wahrnehmung einer ungerechten Rechtsprechung zu verringern, könnten mehrere Maßnahmen ergriffen werden: Regelmäßige Schulungen und Fortbildungen für Richter, Gesetzesreformen zur Schaffung klarer Leitlinien, verbesserte Kommunikation und Transparenz im Justizsystem sowie die Förderung alternativer Streitbeilegung und stärkere Bürgerbeteiligung im Gesetzgebungsprozess.
Durch die Kombination dieser Maßnahmen könnte das Justizsystem gestärkt und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Rechtsprechung wiederhergestellt werden. Letztendlich ist das Ziel, sicherzustellen, dass Urteile nicht nur formell korrekt, sondern auch gerecht und fair sind, um eine wirklich gerechte Gesellschaft zu schaffen.
Ulrich Schild von Spannenberg